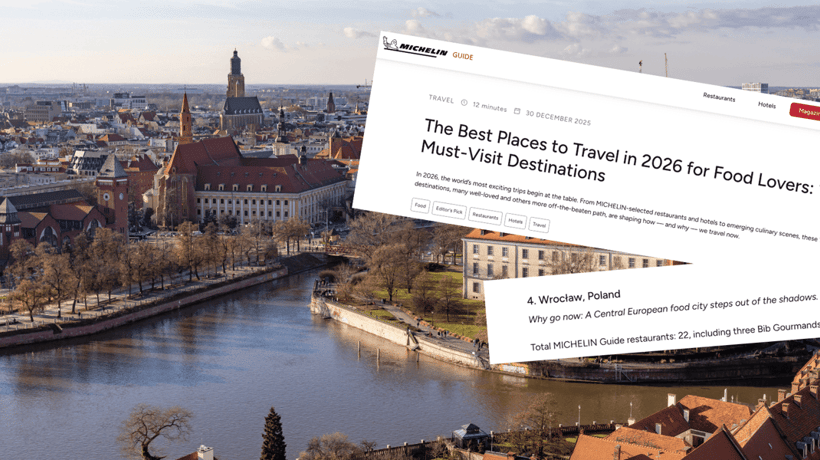Gegenstände aus den Koffern der Breslauer kehren an ihren Platz zurück
Wir sollten die Dinge wieder dahin stellen, wo sie hingehören - eine natürliche und logische Handlung, die uns als Kinder von unseren Großeltern und Eltern beigebracht wurde. Indem wir Ordnung halten, greifen wir automatisch nach den Gegenständen, und ihr Vorhandensein an einem bestimmten, festen Ort hilft uns, Ordnung in das Chaos des Lebens zu bringen, Stabilität zu schaffen.
Manchmal ist es unmöglich, Dinge an ihren Platz zurückzustellen, vor allem wenn ihre Besitzer verschwinden und die Realität um sie herum verändert sich.
In der Ausstellung „Dinge zurückbringen. Breslauer Juden und ihre Gegenstände“ im Haus für Kultur OP ENHEIM werden wir sehen, wie mithilfe von Objekten die Geschichte ihrer Besitzer und ein dramatisches Kapitel der Stadtgeschichte erzählt werden kann.
Gleichzeitig werden wir spüren, wie die Dinge, die einst in Koffern mitgenommen wurden und nach Jahren an ihren Platz in Wrocław zurückgekehrt sind (wenn auch nur für die Dauer der Ausstellung), das frühere Breslau wieder mit dem heutigen Wrocław verbinden.
- „Unsere Ausstellung ist ein Versuch, Verbindungen wiederherzustellen, die künstlich und gegen den Willen der Besitzer dieser Objekte, die gezwungen wurden, Wrocław zu verlassen, unterbrochen wurden. Infolge des Krieges wurde die Stadt zerstört, es folgte ein vollständiger Bevölkerungsaustausch, und aus dem deutschen Breslau wurde das polnische Wrocław. Und obwohl sich die Ausstellung auf jüdische Einwohner konzentriert, erlaubt sie uns, dieses Phänomen viel breiter zu sehen“ – erklärt Karolina Jara von OP ENHEIM.
Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit der Urban Memory Foundation vorbereitet, die sich der Pflege der Erinnerung an die jüdische Bevölkerung Wrocławs aus der Vorkriegszeit widmet.
Seit Jahren nehmen UMF-Mitglieder Kontakt zu Nachkommen jüdischer Breslauer auf, und für die Ausstellung „Dinge zurückbringen“ haben 12 Familien ehemaliger Breslauer auch konkrete Objekte zur Verfügung gestellt.
Silberne Tiara zum Hochzeitstag
Einige der Objekte wurden restauriert, wie das Porträt von Babette Silberstein aus dem 19. Jahrhundert, aus dem Besitz von Stephen und Donald Falk, oder die silberne Tiara und Brosche der Familie Freund und Falk.
– „Am Ende der Ausstellung werden die Gegenstände an ihre Besitzer zurückgegeben - die Nachkommen der Familien, die sie aus Breslau mitgenommen haben. Und sie werden weiterhin bestimmte Aufgaben für sie erfüllen“ – sagt Karolina Jara.
Und die aus Breslau geretteten Gegenstände sind einzigartig für die Erben. Die bereits erwähnte silberne Tiara und Brosche der Familie Freund und Falk zirkuliert in der Familie und wird von Paaren getragen, die gerade ihren Hochzeitstag feiern. – „Es ist eine Tradition, die von dieser besonderen Familie geschaffen wurde und gepflegt wird“ – sagt Karolina Jara.
Babette Silberstein - von Brzeg nach Breslau
Ein Gemälde in den Farben Oliv und Creme. Es zeigt eine hübsche Brünette mit einer aufwendig gestylten Frisur, gekleidet in ein modisches Kleid mit Puffärmeln.
Über Babette Silberstein ist heute wenig bekannt, außer dass sie zusammen mit ihrem Mann nach Breslau aus Brzeg kam. Der Ehemann wurde bald zum Gründer der Synagoge zum Weißen Storch und gab auch ein Porträt seiner Gattin in Auftrag. Traurigerweise starb Babette Ende der 1840er Jahre während einer Choleraepidemie in Breslau und wurde auf dem Friedhof in der ul. Gwarna bestattet.
Das Porträt wechselte mehrmals den Besitzer und hing in Wohnungen bestimmter Familienmitglieder. Dann, als die Zeit der Verfolgung in den 1930er Jahren kam, wurde es von den Nachkommen der Silbersteins in die Vereinigten Staaten mitgenommen.
Dort wurde das Gemälde unglücklich restauriert. – „Unglücklich, weil die Person, die sich an das Bild aus ihrer Kindheit erinnerte, meinte, es sei nicht dasselbe Porträt. Anlässlich der Ausstellung im OP ENHEIM wurde das Porträt einer weiteren Restaurierung unterzogen, bei der die ursprüngliche Farbschicht wiederhergestellt wurde.
Das Porträt von Babette Silberstein wurde für die Ausstellung von Stephen Falk und Donald Falk, die in den Vereinigten Staaten leben, zur Verfügung gestellt. Donald besuchte 1996 zum ersten Mal Wrocław. Er begleitete seine Mutter, die in Breslau auf die Welt kam.
– „Mit jedem Besuch fühlte ich mich mit diesem Ort enger verbunden und vertrauter. Nach Wrocław etwas zu bringen, was ich schätze, ist eine Möglichkeit, meine Familie zu ehren, die hier seit Generationen lebte. Ich denke, dass die Ausstellung das Gespür für den Ort erweitert, indem sie Details des Lebens, das sich hier in der Vergangenheit abgespielt hat, zeigt“ – sagte er vor der Ausstellung.
Die Anhäufung von weiteren Schichten der Geschichte
Die im Laufe der Jahre aufgebauten Schichten sind eines der Leitmotive der Ausstellung „Dinge zurückstellen“. Im ersten Raum sehen wir eine Vitrine mit zwei Mesusot.
Die kleinen Kästchen mit zusammengerollten Pergamentfragmenten der Thora wurden an die Eingänge von Wohnungen, Einfamilien- und Mietshäusern angebracht. Personen, die durch die Schwelle gingen (Bewohner und Besucher), sollten nach der Tradition die Mesusa mit der Hand berühren.
Die in der Ausstellung gezeigten Mesusot wurden bei der Renovierung des Bürgerhauses in den Türrahmen gefunden. – „Es ist nicht bekannt, wem sie gehörten. Man kann nur vermuten, dass sie mit der Familie Oppenheim oder den späteren Bewohnern des Hauses in Verbindung standen. Dies ist ein wichtiges Zeugnis dafür, dass es in diesem Gebäude viele jüdische Mieter gab“ – bemerkt Karolina Jara.
In einem der Räume (im neuen Teil des Gebäudes) haben wir eine künstlerische Intervention der Berliner Künstlerin Anna Schapiro. Sie arbeitete in der Galerie mit der Technik des Abdrucks von Reispapier, das mit verschiedenfarbiger Tinte getränkt war.
– „Sie hinterließen an den Wänden unregelmäßige Kompositionen, die nach dem Ende der Ausstellung überstrichen werden sollen. Sie werden zu einer weitere Schicht der Geschichte, obwohl wir sie nicht mehr sehen werden“ – erklärt Karolina Jara.
Schapiro widmete ihr Werk all jenen, die beim Verlassen der Stadt Breslau nichts mitnehmen konnten.
Die Breslauer gehen - was nehmen sie mit
Ende 1939 lebten in Breslau 13 000 Juden, ein Jahr später emigrierten von ihnen rund 550 Personen, 1941 war es bereits praktisch unmöglich, die Stadt zu verlassen, so die Historikerin Dr. Joanna Hytrek-Hryciuk aus Wrocław in ihrem Buch „Między prywatnym a publicznym. Życie codzienne we Wrocławiu w latach 1938-1944” (Zwischen Privatem und Öffentlichem. Das Alltagsleben in Breslau 1938-1944).
Wenn die erzwungene Emigration in der Zeit gestaffelt ist, kann man Vorkehrungen treffen und die Abreise planen. Der Tisch und die Stühle, entworfen und gefertigt von Albert Hadda, wurden für das Leben im Exil der Familie Goldschmidt angepasst, die in das britische Mandatsgebiet Palästina ging.
Das in Breslau hergestellte Symphonion (ein Spielgerät, das Musik von Zinnplatten abspielt) wurde bewusst ausgewählt, ebenso wie der Kelim mit der Darstellung der Arche Noah, der im Kinderzimmer hing.
Meistens wurden Fotos mitgenommen – private (aus dem Urlaub, mit der Familie, mit Kindern), aber auch „geschäftliche“ – aus der Studienzeit (Berta Simlinger, die spätere Frau von Albert Hadda, bewahrte ein Foto mit ihren Kommilitonen von der Staatlichen Kunstgewerbeschule auf) oder vom Arbeitsplatz (Willy Cohn bewahrte ein Foto mit Schülern und dem Direktor des Gymnasiums St. Johannes in der heutigen Straße ul. Worcella).
– „Fotos und Briefe ließen sich leicht mitnehmen und waren eine Selbstverständlichkeit, besonders in jenen Tagen. Die Bilder von Menschen, die ihnen besonders nah standen, halfen, ihre Gesichter im Gedächtnis zu behalten“ – sagt Karolina Jara.
Unter den aus Breslau mitgenommenen Gegenständen befanden sich jedoch auch Porträts, Farben und Pinsel, die die Frau des verstorbenen Malers und Architekten Heinrich Tischler mitgenommen hatte.
Sie nahm auch die Plakette von der Tür seines Ateliers mit einem Faksimile der Originalunterschrift ihres Mannes ab und bewahrte eine Postkarte des Künstlers aus dem Lager Buchenwald auf, wohin Tischler deportiert worden war. Er erholte sich von seinem Aufenthalt im Lager nicht mehr und verstarb im Herbst 1938.
Zeugnisse der Schande und Ausgrenzung
In der Ausstellung „Dinge zurückbringen“ zeigen die Kuratoren Dr. Malgorzata Stolarska-Fronia und Dr. Maciej Gugala, wie sich die Realität für die jüdische Bevölkerung veränderte.
Seit dem Preußischen Judenedikt von 1812, mit dem Juden zu gleichberechtigten Bürgern wurden, konnten sie an Universitäten studieren, in Stadträten sitzen und öffentliche Ämter bekleiden, bis zu den 1930er Jahren, als die nationalsozialistische Verfolgung und Repression begann.
Die Tatsache, dass die Breslauer viele Dokumente mitnahmen, die die schändliche Politik des Dritten Reiches belegen, zeugt davon, wie ungerecht sie sich behandelt fühlten.
Der Historiker und Lehrer Willy Cohn wurde gezwungen, sich den Namen „Israel“ hinzuzufügen (Dr. Willy Israel Cohn).
– „Juden wurden auf diese Weise stigmatisiert. Cohns Stempel mit der geänderten Namensform sind kleine, aber höchst bedeutsame Objekte, die die Änderungen der Lebensbedingungen und des Wohlergehens von Menschen zeigen, die früher als bedeutende gesellschaftliche Persönlichkeiten galten. In den 1930er Jahren wurde ein Gesetz erlassen, das dies plötzlich änderte“ – erklärt Karolina Jara.
Bewegend ist der Brief von Albert Hadda vom November 1934, in dem der Architekt erfolglos versucht, gegen das Berufsverbot Einspruch zu erheben.
Das ergreifendste Zeugnis ist allerdings ein Brief von Olga Herz, einem Mitglied der Familie Herz (die Familie betrieb ein Schuhgeschäft im Haus Oppenheimer) an ihre Enkelin Steffi.
Steffi gelang es zusammen mit ihren Eltern, nach Chile auszuwandern. Die achtzigjährige Großmutter blieb in Breslau. In einem persönlichen Brief gratuliert sie Steffi zum Geburtstag, verabschiedet sich aber auch von seiner Enkelin und schreibt, dass sie sich nicht wiedersehen werden.
Olga Herz wurde schließlich in das Durchgangslager Grüssau (Krzeszów) und anschließend in das Lager Theresienstadt im tschechischen Terezin deportiert, wo sie starb.
Nachkommen der Breslauer in der Ausstellung in Wrocław
Anlässlich der Ausstellungseröffnung kamen nach Wrocław Nachkommen jüdischer Breslauer, die heute in der ganzen Welt leben, u. a. in England, den Vereinigten Staaten, Israel, Schweden, Belgien und Deutschland.
– „Es war für sie eine Gelegenheit, sich zu treffen, zumal sich viele von ihnen vorher nicht kannten, doch bei den Vorbereitungen der Ausstellung entstand eine Freundschaft zwischen ihnen, die anhalten wird. Auch für uns als Organisatoren ist es eine außergewöhnliche Erfahrung“ – bemerkt Karolina Jara.
Nach Wrocław kamen sogar 26 Nachkommen jüdischer Breslauer, mit denen man während des Treffens und der Vernissage sprechen konnte.
Die Breslauer-Ausstellung demnächst auch online
Die Ausstellung „Dinge zurückbringen. Breslauer Juden und ihre Gegenstände“ läuft noch bis zum 22. September.
– „Ein Teil der Objekte wurde gescannt und soll auch online gezeigt werden. Zur Ausstellung wird es auch eine Publikation geben, die sich mit den verschiedenen Kontexten der ausgestellten Objekte befasst“ – kündigt Karolina Jara an.